Digitale Souveränität: Europas dringende Lehre aus dem Cloudflare-Ausfall

Am heutigen 18. November 2025 zeigt sich erneut, wie fragil die Grundpfeiler unserer digitalen Infrastruktur sind. Ein massiver Ausfall von Cloudflare-Diensten legt weltweit zahlreiche Websites und Anwendungen lahm und führt vor Augen, wie abhängig wir von wenigen nicht-europäischen Technologiekonzernen geworden sind. Dieser Vorfall ist kein Einzelfall, sondern Symptom eines grundlegenden Problems, das Deutschland und Europa endlich entschiedener angehen müssen.
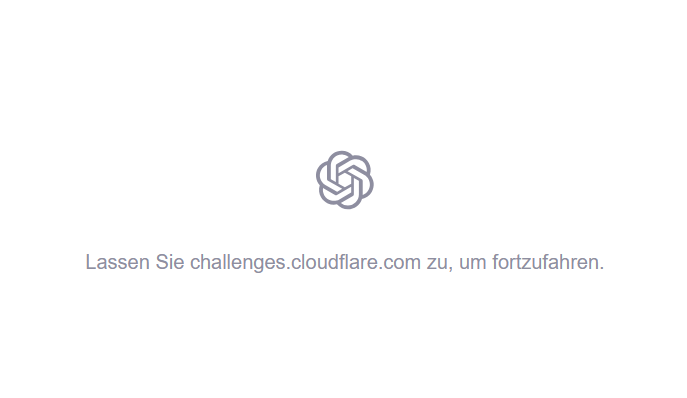
Die digitale Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern hat sich zu einem systematischen Risiko entwickelt. Wenn ein einzelnes Unternehmen wie Cloudflare ausfällt, zieht das Kettenreaktionen globaler Dienstleistungen nach sich.
Neben Twitter auch ChatGPT und wer weiß was noch, so viel habe ich noch gar nicht nachgeprüft. Millionen von Menschen können nicht mehr arbeiten, kommunizieren oder auf essentielle Dienste zugreifen. Die wirtschaftlichen Schäden solcher Ausfälle gehen in die Millionen, doch die langfristigen Folgen für unsere digitale Souveränität sind noch weitaus gravierender.

Digitale Souveränität bedeutet nicht Abschottung oder technologische Autarkie. Es geht vielmehr darum, dass Europa über ausreichende eigene Fähigkeiten verfügt, um im digitalen Raum selbstbestimmt handeln zu können. Und nicht anderen Staaten, Irren oder Supermächten ausgeliefert zu sein. Wir müssen in der Lage sein, kritische digitale Infrastrukturen zu kontrollieren, zu gestalten und zu schützen, ohne von einzelnen Anbietern oder Ländern abhängig zu sein. Die heutige Situation demonstriert schmerzlich, dass wir diesen Zustand noch lange nicht erreicht haben.
Was steckt hinter Cloudflare? (toggle)
Cloudflare ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das verschiedene technische Services anbietet, die gewährleisten, dass Webseiten schneller, sicherer und stabiler laufen. Dazu gehören unter anderem ein sogenanntes Content Delivery Network (CDN), das Inhalte weltweit verteilt und so Ladezeiten verkürzt, sowie Schutzmechanismen gegen Cyberangriffe. (via)
Deutschland und Europa haben die Ressourcen, das Know-how und die wirtschaftliche Stärke, um eine Vorreiterrolle in der digitalen Transformation einzunehmen. Doch dafür bedarf es einer konsequenteren Strategie. Wir müssen in europäische Cloud-Infrastrukturen investieren, offene Standards fördern und die digitale Bildung stärken. Die europäische Gaia-X-Initiative zeigt, dass der Wille zur Veränderung vorhanden ist, doch die Umsetzung muss deutlich beschleunigt werden.
Was ist Gaia-X (toggle)
Gaia-X ist ein 2019 vorgestelltes Projekt zum Aufbau einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Dateninfrastruktur für Europa, das von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung aus Deutschland und Frankreich gemeinsam mit weiteren, vorwiegend europäischen Partnern getragen wird.
Die aktuelle Krise sollte ein Weckruf für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sein. Wir benötigen dringend eine Stärkung der europäischen Digitalwirtschaft, die Entwicklung alternativer Infrastrukturen und klare rechtliche Rahmenbedingungen, die europäische Werte und Datenschutzstandards garantieren. Nur so können wir verhindern, dass unsere digitale Zukunft von Entscheidungen bestimmt wird, die außerhalb Europas getroffen werden.
Der Weg zur digitalen Souveränität ist anspruchsvoll und erfordert erhebliche Investitionen. Doch die Kosten des Nicht-Handelns sind ungleich höher. Jeder Ausfall wie der heutige zeigt, dass wir uns keine Halbherzigkeit mehr leisten können. Es geht um nicht weniger als die Bewahrung unserer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, demokratischen Stabilität und technologicalischen Unabhängigkeit.
Angesichts der anhaltenden Abhängigkeit von nicht-europäischen Technologiekonzernen braucht es jetzt konkrete Maßnahmen und politische Weichenstellungen. Diese Forderungen müssen sich an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft richten.
Öffentliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen müssen verpflichtet werden, europäische Cloud-Dienste zu nutzen, sofern diese den erforderlichen Standards entsprechen. Mindestens fünfzig Prozent der digitalen Infrastruktur für öffentliche Dienstleistungen sollten bis 2030 auf europäischen Plattformen laufen. Die Gaia-X-Initiative muss von einer Vision zu einer praxistauglichen Alternative ausgebaut werden, die mit den großen globalen Anbietern konkurrieren kann.
Die europäische Gesetzgebung muss konsequent auf digitale Souveränität ausgerichtet werden. Verbindliche Vorgaben für Interoperabilität und offene Standards, die es ermöglichen, zwischen verschiedenen Anbietern zu wechseln ohne Lock-in-Effekte. Das Wettbewerbsrecht sollte so angepasst werden, dass es den Markteintritt europäischer Alternativen aktiv fördert statt nur die Marktmacht großer Konzerne zu beschränken.
Die digitale Bildung muss vom Kindergarten bis zur Universität grundlegend reformiert werden. Wir fordern eine Verdopplung der Fördermittel für informationstechnische Studiengänge und die Einrichtung von mindestens zwanzig neuen Exzellenzzentren für KI-Entwicklung in Europa. Die Vergabe von Forschungsmitteln sollte an die Bedingung geknüpft werden, dass entwickelte Technologien als europäisches Gemeingut erhalten bleiben.
Für kritische Infrastrukturen braucht es verbindliche Vorgaben zur technologischen Herkunft, dass in den Bereichen Energie, Gesundheit, Finanzen und Verkehr nur noch solche digitalen Systeme zum Einsatz kommen, deren Quellcode europäischen Aufsichtsbehörden vollständig offengelegt wird und deren Datenhaltung uneingeschränkt der europäischen Datenschutz-Grundverordnung unterliegt.
Statt auf zentrale Großprojekte sollten wir auf föderierte Ansätze setzen. Wir fordern die Entwicklung eines europäischen Digitalen Ökosystems, das die Stärken verschiedener nationaler Initiativen verbindet. Ein europäischer Cloud-Verbund könnte die Kapazitäten unterschiedlicher Anbieter bündeln und so eine echte Alternative zu den hyperscale Cloud-Anbietern schaffen.
Und ich hatte ja neulich schon mal mit dem Gedanken gespielt, es zumindest spannend zu finden, würden wir selbst ein eigenes Social Network entwickeln, ein ÖD-Social-Media Netzwerk? Und das ist nur ein kleiner, winziger Punkt, der aber genau in diese Souveränitätsdebatte rein geht.
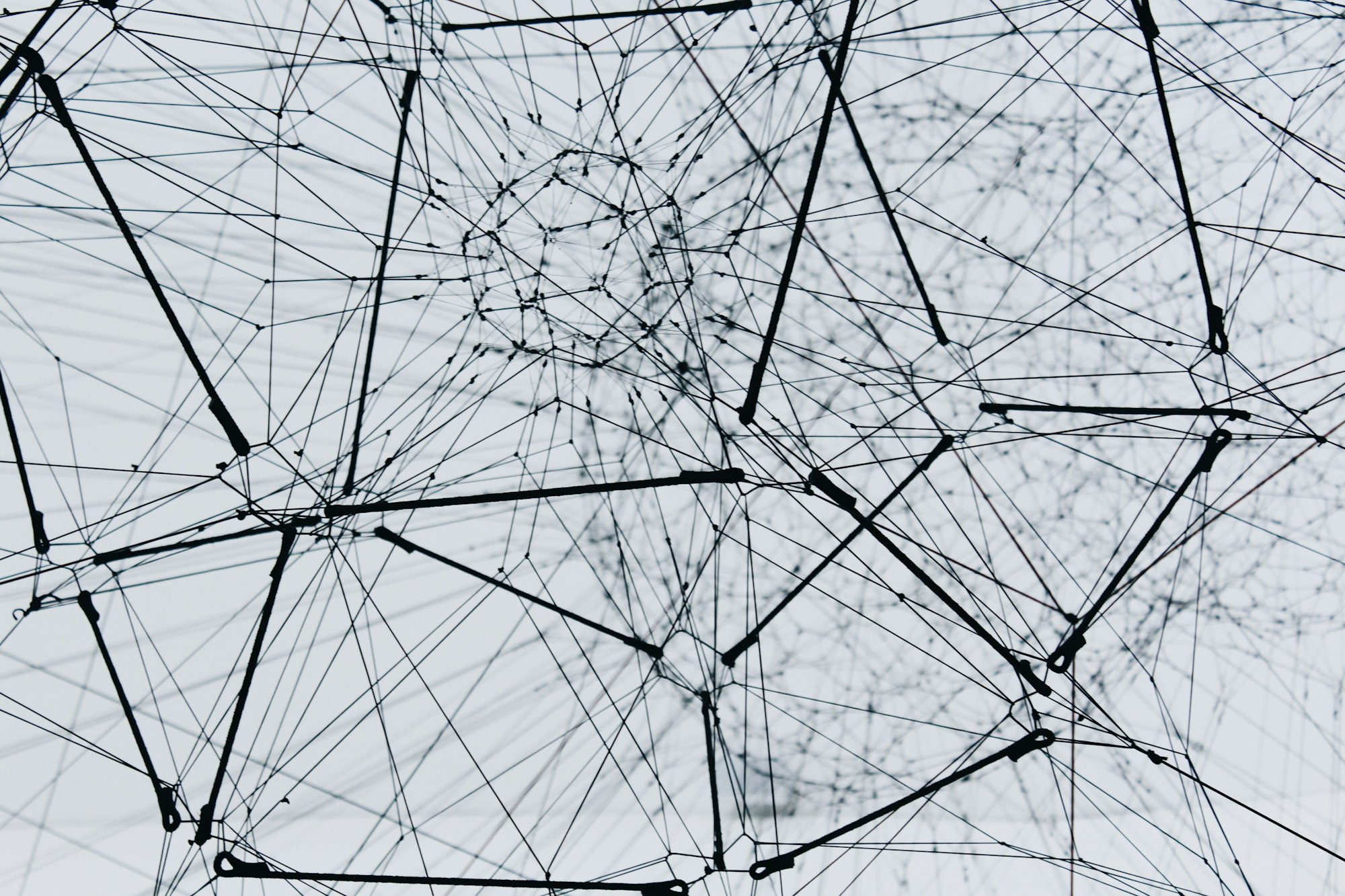

Kommentare und Reaktionen
Reaktionen
Lade Interaktionen...











