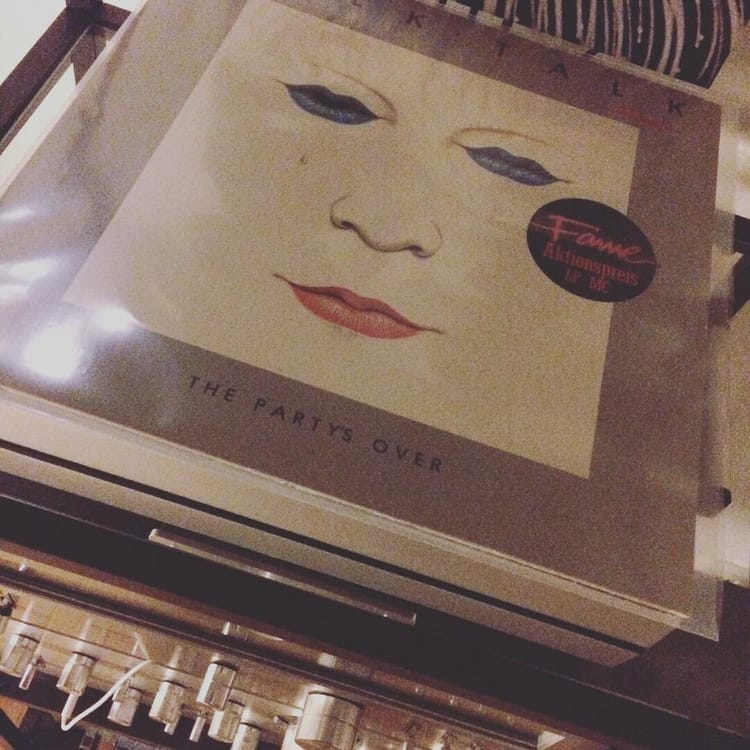The Grateful Dead

Weil ich gerade meine MP3 (FLAC) Dateien aufräume und neu tagge, bin ich mal wieder über Greatful Dead gestolpert. Vor allem der Song Fire on the Mountain hat mich damals live ziemlich erreicht. Vielleicht, weil ich selber oft ein Feuer im Oberstübchen hab. Vielleicht aber auch, weil die Grateful Dead eine dieser Bands sind, die weniger über einzelne Songs funktionieren als über Zustände. Über Dauer. Über das, was zwischen den Tönen passiert.
Man kann die Grateful Dead kaum hören, ohne sofort in Zuschreibungen zu geraten: Jam-Band, Hippie-Soundtrack, LSD-Folklore, endlose Konzerte, bunte Bären, Jerry Garcia als Ikone. Und genau das liebe ich aber auch, schon bei den Doors hat mich das Schamanenhafte total fasziniert, wenn Jim in die Wüste gerannt ist um Meskalin zu nehmen oder mit einer Schah Menschen auf einem Konzert wie eine Polonese durch den Saal marschierte, nackig.
Das alles stimmt – und ist gleichzeitig viel zu kurz gegriffen. Denn die Grateful Dead waren nicht einfach eine Rockband, sondern ein kulturelles Experiment, das über Jahrzehnte lief. Mit offenem Ausgang. Und mit Kollateralschäden. Bis heute!
Greatful Dead - Fire On The Mountain Live
Eine Band ohne Zentrum – und genau deshalb mit Wirkung
Gegründet Mitte der 1960er in San Francisco, mitten im Epizentrum der amerikanischen Gegenkultur, waren die Grateful Dead von Anfang an anders organisiert als die meisten ihrer Zeitgenossen. Zwar gab es mit Jerry Garcia eine klare Identifikationsfigur, aber nie den klassischen Frontmann. Die Band war ein Kollektiv, manchmal fast eine lose Föderation musikalischer Ideen. Entscheidungen wurden diskutiert, ausprobiert, verworfen. Songs waren selten abgeschlossen. Sie entwickelten sich über Jahre hinweg – oder zerfielen wieder.
Ein Grateful-Dead-Konzert war kein reproduzierbares Produkt. Es war ein Ereignis. Man wusste nie, wie lange ein Song dauern würde, ob er sich auflöste, in ein anderes Stück überging oder völlig entgleiste. Genau darin lag der Reiz. Und genau darin lag auch die Zumutung. Martin Kohlstedt macht heute genau sowas: Er hat ein gewisses Repertoire an Songs und Stücken und Sounds und ansonsten improvisiert er aus bestehenden Songstrukturen neue Kunstwerke live auf der Bühne.
Improvisation als Haltung
Improvisation bei den Grateful Dead war kein Solo-Egotrip, sondern eine kollektive Praxis. Anders als im klassischen Rock, wo Improvisation oft bedeutet: einer spielt, die anderen begleiten, funktionierte das bei den Dead eher wie ein Gespräch. Musiker hören einander zu, reagieren, widersprechen, fallen sich ins Wort, lassen Raum.
Das hatte viel mit Jazz zu tun, aber auch mit Bluegrass, Folk und experimenteller Musik. Phil Lesh spielte Basslinien, die eher melodisch als rhythmisch waren. Bob Weir arbeitete mit ungewöhnlichen Akkorden und Rhythmen. Garcia war kein Virtuose im klassischen Sinne, aber ein extrem sensibler Gitarrist, der Linien suchte statt Effekte.
Diese Offenheit hatte Einfluss. Nicht nur auf spätere Jam-Bands wie Phish oder Widespread Panic, sondern auch auf die Art, wie Live-Musik gedacht wurde. Konzerte als einmalige Erfahrung, nicht als perfekte Reproduktion einer Platte – das ist heute fast selbstverständlich, war damals aber ein Gegenentwurf zur aufkommenden Rock-Industrie.
Die Deadheads – Publikum als Teil des Systems

Vielleicht noch wichtiger als die Musik war das Verhältnis zwischen Band und Publikum. Die sogenannten Deadheads waren keine Fans im klassischen Sinn. Sie waren Teil eines sozialen Netzwerks, das sich von Konzert zu Konzert bewegte. Menschen folgten der Band quer durch die USA, verkauften selbstgemachte Shirts, tauschten Tapes, lebten temporär außerhalb normaler ökonomischer Strukturen.
Die Grateful Dead haben dieses Verhalten nicht nur toleriert, sondern aktiv unterstützt. Sie erlaubten – ja förderten – das Mitschneiden ihrer Konzerte. In einer Zeit, in der Bootlegs als Bedrohung galten, öffneten sie den Raum. Das war radikal. Und es war visionär.
Ohne es so zu nennen, haben die Grateful Dead damit etwas vorweggenommen, das heute selbstverständlich ist:
- Community statt Konsument
- Zirkulation statt Besitz
- Prozess statt Produkt
Man kann durchaus argumentieren, dass viele heutige Formen von Open-Source-Denken, Fan-Kulturen und netzbasierter Zusammenarbeit hier einen kulturellen Vorläufer haben. Nicht technisch, sondern mental.

Technik, Sound und das Wall of Sound
Auch technisch waren die Grateful Dead Vorreiter. Das berühmte Wall of Sound-PA-System der frühen 1970er war nicht nur gigantisch, sondern konzeptionell neu. Ziel war nicht Lautstärke, sondern Klarheit. Jeder Musiker hatte sein eigenes Lautsprechersystem, Gesangsmikrofone waren phaseninvertiert, um Rückkopplungen zu vermeiden. Der Aufwand war absurd. Der Transport ruinös. Aber der Klang war revolutionär.
Diese Besessenheit von Soundqualität hatte Folgen für die gesamte Live-Industrie. Viele heute selbstverständliche Standards im Beschallungsbereich wurden von Technikern entwickelt, die bei oder mit den Grateful Dead gearbeitet haben. Auch hier wieder: kein kurzfristiger Erfolg, sondern langfristiger Einfluss.
Fire on the Mountain – ein Song als Zustand
Fire on the Mountain ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein vergleichsweise simples Stück zu etwas Größerem werden kann. Der Song selbst ist strukturell überschaubar, fast zurückhaltend. Aber live öffnet er Räume. Er ist weniger Erzählung als Atmosphäre. Ein schwelendes Gefühl, das sich langsam ausbreitet.
Vielleicht ist es genau das, was viele Menschen – mich eingeschlossen – daran so trifft. Dieses latente Brennen. Nicht Explosion, sondern Glut. Ein inneres Feuer, das nicht unbedingt zerstört, aber auch nicht zur Ruhe kommt.
Die Texte der Grateful Dead sind oft rätselhaft, fragmentarisch, voller Anspielungen. Robert Hunter schrieb keine klassischen Rocklyrics, sondern poetische Miniaturen, die eher Assoziationen auslösen als Bedeutungen festlegen. Auch das trägt dazu bei, dass die Musik nicht altert. Sie legt sich nicht fest.
Die dunkle Seite: Drogen, Heroin, Verlust
So viel zur Mythologie. Aber man kommt nicht umhin, über die Schattenseiten zu sprechen. Ich liebe es, nicht weil ich darin bade, sondern weil ich selbst dunkle Schatten auf der Sonne sehe, die negativen, zerstörerischen und dunklen Momente eines Künstlers, nein, eines Menschen, zu sehen. Zu beschreiben. So wie auch in meinem Artikel über Townes van Zandt. Die Grateful Dead sind untrennbar mit Drogen verbunden. LSD als bewusstseinserweiterndes Werkzeug spielte in den frühen Jahren eine zentrale Rolle. Darüber kann man diskutieren, historisch einordnen, vielleicht sogar differenziert urteilen.

Heroin hingegen ist eine andere Geschichte. Eine zerstörerische. Eine, die Körper, Beziehungen und Lebensläufe frisst. Neben Nico hat das Heroin auch Jerry verreist.
Jerry Garcia war jahrzehntelang heroinabhängig. Nicht als romantischer Rockstar-Exzess, sondern als schleichende Krankheit. Seine Stimme veränderte sich, sein Spiel wurde phasenweise unkonzentrierter, seine Präsenz brüchiger. Die Band machte weiter. Die Touren liefen. Das System funktionierte – auf Kosten der Menschen darin.
Heroin wirkt nicht spektakulär. Es zerstört leise. Es nimmt Antrieb, verengt den Horizont, verschiebt Prioritäten. Und es ist gnadenlos. Viele im Umfeld der Dead starben früh oder verschwanden. Andere trugen bleibende Schäden davon.
Freiheit ohne Halt
Vielleicht liegt hier auch ein Kernproblem der Grateful-Dead-Utopie. Die Idee radikaler Freiheit, von Offenheit, von permanentem Unterwegssein, funktioniert nur begrenzt ohne Struktur. Ohne Grenzen. Ohne Fürsorge, die mehr ist als Loyalität.
Die Band war über Jahrzehnte unterwegs. Immer weiter. Aufhören war keine Option. Stillstand wurde vermieden. Und genau das führte dazu, dass Probleme – persönliche wie strukturelle – nicht wirklich gelöst, sondern umspielt wurden.
Das Publikum wollte die Dead. Die Dead wollten spielen. Der Kreislauf schloss sich. Bis er nicht mehr trug.
Bedeutung trotz allem
Und trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – bleiben die Grateful Dead bedeutend. Nicht, weil sie perfekt waren. Sondern weil sie Dinge ausprobiert haben, die sonst niemand wagte. Weil sie sich der Logik von Effizienz, Hitparade und Verwertbarkeit entzogen haben. Weil sie gezeigt haben, dass Musik ein sozialer Raum sein kann.
Man kann ihre Musik lieben oder ablehnen. Man kann sie langweilig finden, selbstverliebt oder zu lang. Alles legitim. Aber man kann sie nicht auf einen Stil oder eine Epoche reduzieren.
Die Grateful Dead waren ein Versuch. Einer, der Jahrzehnte dauerte. Mit Höhen, Tiefen, Irrwegen und echten Errungenschaften. Und mit Kosten, die man nicht ignorieren sollte.
Vielleicht ist es genau das, was beim Wiederhören bleibt, wenn man seine Musikbibliothek aufräumt und plötzlich wieder Fire on the Mountain läuft: das Wissen, dass Kreativität immer auch Risiko ist. Dass Freiheit nicht unschuldig ist. Und dass manches Feuer wärmt – und anderes verbrennt.
Und vielleicht reicht das schon, um diese Band immer wieder neu zu hören. Nicht aus Nostalgie. Sondern aus Respekt vor einem offenen, widersprüchlichen, zutiefst menschlichen Projekt.
Was and is now forever one of the Grateful Dead
Herr Montag ist Musikfreund, der sich gern mit der Erforschung ikonischer Künstler beschäftigt. Weitere Artikel finden Sie auf herrmontag.de.